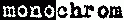Helge Schneider für Kinder.
Protokoll einer Besichtigungsfahrt an die Nahtstelle des siamesischen
Zwillings >>Sinn/Unsinn<<
Glaubt da draußen noch wer, Helge Schneider wäre bloß irgend so eine Ulknudel und nicht der Rede wert? Seine Entwicklung zum "kulturellen Phänomen" vollzog sich in den 90ern analog zur breitärschigen Ausdifferenzierung des "Comedy"-Segments als spezifischer Humorform der Neuen Mitte, die von der Alten Mitte im Begriff der "Spaßgesellschaft" wiederum begreint wird. Als deren Protagonist musste Schneider dem genretypisch- ungenauen Hinschauen des Feuilletons erscheinen: Von den Plateauschuhen und räudigen Perücken bis zur Jingle Bells-Dekonstruktion Katzeklo [1] wird er als postmodernistisch eingefärbtes Relaunch des deutschen Sonder-Formates "Blödelbarde", höchstens noch aber als irgendwie ungenießbare Mischung aus Mike Krüger und Sun Ra, rezipiert. Selbst ein intellektueller Naturbusche wie Reinhold Messner darf ihm öffentlich bescheinigen, er sei "etwas für sehr bescheidene Köpfe. Diese Form von Kabarett ist mir zu simpel. Da gehört meiner Vorstellung nach mehr Geist und Hintergrund rein." [2]
Wenngleich sich die Leitkulturhammel beinahe gierig auf jene Angriffsfläche gestürzt haben, die Schneider ihnen irgendwie jesusmäßig hinhält, so ist doch aus den zahllosen Verlächerlichungen und Weg-Erklärungen seines Schaffens ein latentes Unbehagen herauszuspüren – es scheint eine monumentale Unverständlichkeit von diesem Werk auszugehen, etwas Fremdartiges, das sich nicht in den Reiz-Reaktionsschemata erlernten bildungsbürgerlichen Verhaltens einfangen, reflektieren und kanalisieren lässt.
Dem stehen nicht gerade viele Texte gegenüber, die willens sind, in Schneider mehr zu erblicken. Diesbezügliches Kuriosum dürfte wohl ein von Jens Hagestedt verfasstes Radioessay sein, in dem man/frau/sonstige erfährt, Schneider gelte "unter Fachleuten als einer der besten [Richard] Straußkenner unserer Zeit" und zu einer gelehrten Neubewertung angesetzt wird:
"Eine Stimme, die prägnant über drei Oktaven hinweg auf geringste Ausdrucksinnervationen anspricht. Mit der Fähigkeit nicht nur diese Stimme immer wieder anders zu timbrieren, sondern ... das Timbre und den Ausdruck von einem auf den anderen Augenblick zu wechseln, mit einer Präsenz schließlich, um die ihn die meisten ausgebildeten Sänger beneiden dürften. [...] Es gibt heute, die Klassikszene eingeschlossen, kaum einen zweiten Sänger, der das Hochdeutsche so gut artikuliert als Helge Schneider." [3]
Und das beste daran ist: Es stimmt sogar! Ebenfalls dem musikalischen Schaffen widmet sich Eckhard Schumacher im Merkur [4] . Er lotet dessen über- und unterirdische Verbindungen zu Kultur und Tradition des Jazz aus, ohne dass schon der Versuch gemacht würde, Schneiders Arbeitsweise insgesamt vom Jazz her verstehen zu wollen. Diese These habe ich, gestützt auf eine Selbstaussage Schneiders [5] , in einem früheren Text entwickelt, in dem ich versucht habe, ein Kategoriensystem zu entwerfen, mit dem Schneider, wenn erst einmal Historizität über ihn gewachsen sein würde, von der Germanistik erfasst werden könnte. [6]
Zwischenzeitlich ist mir dann noch eine sehr umfangreiche monographische Arbeit zugespielt worden, die Schneider bereits per Untertitel ("Philosophieren nach Helge Schneider") als ein Phänomen der Philosophie ausweist [7] – wobei damit keineswegs ein Haffmanns-TB-Schenkelklopper-Konstrukt in Neufrankfurter Schuluniform à la "Philosophieren nach Lothar Matthäus" gemeint ist. Die in Schneiders Werk getriebenen Suchpfade sind hier das Denken des Poststrukturalismus, die philosophische Tradition des Kynismus usw.
Den spätestens jetzt allfälligen Aber-RuferInnen kann indes mit dem Autoren selbst über den Mund gefahren werden:
"Wenn Schneider in Bezug zu neueren philosophischen Ansätzen gesehen wird, wie etwa die Dekonstruktion, die Posthistorie, das rhizomatische Denken, das pensiero debole, so heißt das nicht, dass er diese Ansätze kennen, also durchdacht haben muss, aber sie gehören zum Denkbaren und deshalb ist diese Affinität, selbst wenn sie zufällig ist, sinnvoll." [8]
Keineswegs soll damit also bedeutet werden, Schneider habe Bücher von Deleuze/Guattari, Foucault, Kristeva, Derrida, Kléber oder meinetwegen Die Kritik der zynischen Vernunft im Regal stehen. "Sicherlich legen wir hier das Philosophische hinein. [...] Aber man zeige mir doch erstmal einen Komiker als Gefäß, in das man so etwas hineinlegen kann." [9]
Im folgenden möchte ich also die Dekonstruktion als Kennzeichen des Schneiderschen Werkes in dieses selbst hineintragen, um in der Tradition von Lyotards Postmoderne für Kinder einen etwas bekömmlicheren Zugang zu dessen Kompliziertheit und Schwierigkeit zu trassieren, ohne mich sogleich in eine Plattitüde à la "aller Humor ist Dekonstruktion" einmümmeln zu wollen. Es geht dabei auch darum, einen signifikanten und humortheoretisch relevanten Unterschied zu markieren zu "Comedy" (der Schneider fälschlicherweise oft zugeschlagen wird), der über das bloße Begabungsproblem, das Comedy und Schneider voneinander unendlich trennt, hinausgeht.
Exkurs: Die "Spaßgesellschaft" der Gesellschaft
In den letzten Jahren wurde die sogenannte "Spaßgesellschaft" zum Popanz einer nicht unverdächtigen Hysterie aufseiten eines nicht minder suspekten Gemenges aus Humanismus, Kulturzuständigkeit, Schwafler-in-der-Wüstetum und deren AusläuferInnen in neurechter Kulturpessimismus-Pathetik gemacht, allseits als kulturelles worst case Abendlandsend-Szenario beseufzt und mit jammerläppischem Degout kritisiert, aber nicht so richtig, sondern mehr so "sozial-" oder "gesellschaftskritisch", also möglichst diffus und folgenlos. Getroffen werden soll in diesem Begriff ein komplett inhomogenes Ensemble postmoderner Kulturphänomene, die alle gemein haben, dass sich an ihnen hervorragend eine Krisis des berüchtigten abendländischen Wertekanons herbeischreiben lässt. Als Austragungsort eines Kulturkampfes verschiedener herrschender Klassen ist dies natürlich höchst durchsichtig: Die social overtones sind leicht herauszuschmecken, ebenso die schweinslederne Kastrationsangst eines "E" durch ein sich unangenehm breit machendes "U", die das Soziale nur als Bedrohung des eigenen Sonderstatus zu denken vermag. Kann in einer Séance mit Bourdieu hinreichend geklärt werden.
Bei Licht betrachtet blaffen sich also Unschärfe und Unverschämtheit dieses fadenscheinigen und zutiefst tautologischen [10] Begriffs der Spaßgesellschaft unverwandt an, er muss durch kritische Analyse seines Gegenstandes überwunden werden.
Miteingeschlossen in die "Spaßgesellschaft" sind bestimmte (im guten wie im schlechten Sinne) transgressive Formen von Humor, die sich nicht an das Referenzsystem bürgerlicher Ästhetik anschließen lassen und demzufolge als "banal", "oberflächlich", "platt" oder "infantil" besorgenfältelt werden können. Vor einem solchen Hintergrund sind Schneider und Comedy phänomenologisch zusammengedacht: Katalysator dieser Synthese ist die doppelte Negation werthaft besetzter Begriffe, wie sie die Kritik als "oberflächlicher Unsinn" behauptet: der abgedunkelte und kunstreligiös verklärende der "Tiefe" (der deutsche Wald unter den Kulturonkelfloskeln) sowie der der erhellend-kommunikativen Vernünftigkeit im Sinne von Habermas. Eine solche Kritik verbleibt noch jeweils im schlecht gelüfteten Dunstkreis jener klassisch-ideologischen Trinität vom Schönen-Guten-Wahren. Die skizzierte Tiefe-Vernunft-Dichotomie besitzt als binärer Code ihrerseits entsprechend dichotomische Humortypen: einen "humoristischen Tiefsinn" einerseits, dem als neuere Eingemeindung noch die Kompromisslösung vom "höheren Blödsinn" (für bereits kanonisierten Unsinns-Humor wie Morgenstern oder Gernhardt) zugehört, andererseits diskursiv-funktionale Humortypen, hier vor allem die Satire.
Bislang ist das gesellschaftliche Subsystem "Humor" noch weitgehend theorielos geblieben. Humortheorien liegen nur zusammenhanglos vor – hier Jean Paul, dort Freuds Abhandlung über den Witz (die übrigens im Witz bereits einen Austragungsort von Ressentiments sieht) und als zeitgenössische Variante die seit Jahren fest im Mittelteil der Titanic installierte Rubrik Humorkritik, deren feuilletonistisch-geschmäcklerische und "eindimensionale" [11] Kanonpflege sich allerdings in der Tradition heißgelaufener BildungsspießerInnen wie Eckhard Henscheid von jeglicher Relevanz außerhalb des Raben verabschiedet hat.
Auch linke Theoriebildung hat das Feld "Humor" bisher erstaunlicherweise vernachlässigt, wenn sie sich nicht überhaupt so distanzlos wie unreflektiert an das elitäre Spaßgesellschafts-Bashing angeschlossen hat. Dabei wäre doch gerade hier ein Hauptumschlagsplatz ihrer Themen zu finden. Rassismus und Sexismus z.B. werden ja in der Comedy-Hour auf Pro7 mindestens genauso öffentlich ausagiert wie etwa auf Wahlkampfreisen Stoibers. Hier findet eben kein "Niedergang von Kultur" statt, sondern deren Fortsetzung mit anderen, aggressiveren Mitteln.
Humorformen sind nicht ablösbar von den sie umgebenden gesellschaftlichen Bedingungen, d.h. jeder Humor, noch der scheinbar sinnfreieste, bleibt letztlich bezogen auf das, was er aufzulösen scheint: "Sinn" als Effekt gesellschaftlicher Produktion. Ein Humor, der sich den gesellschaftlichen Herstellungsweisen von "Sinn" (zu denen er gehört) verschließt, wäre als solcher gar nicht mehr erkennbar. Vielmehr besteht sein Sinn als Humor ja gerade in einem humorvollen Umgang mit "Sinn". Er entkommt ihm auch da nicht, wo er sich aus einer vorgeblichen Abkehr von Sinn und Diskurs, nämlich als "Unsinn", legitimiert, so wie Comedy dies bisweilen tut, um sexistische und rassistische Übergriffe hinter einem "War doch bloß Spaß!" gegen diskursive Kritik zu immunisieren und ihre KritikerInnen als lustfeindliche Spaß-Muffel kaltzustellen.
Als "Sprechen" bleibt Humor so in dem Derridaschen Paradox der Sprache befangen, kein Außen zu besitzen, kurz: der prinzipiell sinnstiftenden Tätigkeit von Humor kann nie entkommen werden. Ihr kann nur begegnet werden, indem das Spiel der Sinnerzeugung bewusst aufgenommen wird, anstatt sich nur in den ausgetretenen Spurrinnen eines bestimmten schon verfassten und konventionalisierten Sinns dahinzuschleppen. Helge Schneider tut dies, indem er Sinn (das Feld gesellschaftlicher Bedeutungszuschreibungen und seiner Produktionsweisen) in andere Konstellationen bringt als solche Humortypen, deren Produktion von Sinn bei aller formalen Anarchie in der Regel konform geht mit dem Status Quo. Der Anarcho-Konformismus besteht hier darin, dass die herrschenden Ansichten und spezifischen Vorurteile des Publikums bestätigt und in eine leicht handhabbare, humoristische Form gebracht werden, d.h. vom Anderen/Fremden in einer Weise gehandelt wird, wie schon Freud sie für den "Witz" herausgearbeitet hat. Dies ist nicht historisch neu, schon im alten Rom soll es ja bekanntlich "Phönizierwitze" gegeben haben.
Die scheinbar so gegensätzlichen Gattungen "Satire" und "Comedy" können unter diesem Aspekt als Produktionsstätten und Standortfaktoren kapitalistisch-bürgerlicher Ideologie in deren jeweiligen, auseinander hervorgehenden geschichtlichen Formationen beschrieben werden.
Von der historischen Aufklärung wurde Satire als Mittel zur Ausbreitung von "Wahrheit" eingesetzt. In ihr sollte ein falsches Leben, der "Schein", dargestellt und kenntlich gemacht werden, um somit (freilich unter Aufsicht der Vernunft als moralisch-praktische Instanz) zur Erkenntnis des richtigen zu gelangen. Satire ist hier Zweckform, die ihren Stoff relativ unproblematisch und einsträngig in ein Spiegelverhältnis von Idealität und Realität bringt. Ihr bevorzugtes Mittel ist die Überzeichnung und ihr Personal häufig nur durch die eine (vom Wertekanon aus negativ bewertete) Eigenschaft charakterisiert, die es jeweils wiederum zu charakterisieren hat [12] . Z.B. besteht ein Grundmuster satirischen Erzählens in der Darstellung von ex-zentrischen, extremen Verhaltensweisen und Eigenschaften als Schwundformen und krankhafte Auswüchse des bürgerlichen Tugendkatalogs (z.B. Geiz als Verzerrung der Sparsamkeit). Hierin wird jene "gesunde Mittellage" propagiert, in der sich historisch das Bürgertum in seiner Zwischenstellung zwischen Adel und Pöbel zum Sitz einer abwägenden Vernunft, zum Maß aller Dinge und (wie in Hegels Geschichtsbegriff) zum Mittelpunkt und Sinn der Welt verklären konnte und von der aus alle Abweichungen pathologisch werden.
Die aufklärerische Satire ist also bereits ein Mittel, das Andere des männlich-weiß-heterosexuellen Erkenntnissubjektes der Aufklärung zu besprechen, ohne dass dieses selbst zu Wort kommen dürfte: die "Opfer", an denen sich eine "aufgeklärte" Lachlust delektiert, sind häufig genug Frauen, die unteren Schichten, andere Rassen, Marginalisierte, jene, die oft nicht "zurückschreiben" können, da sie gerade durch jenen Objektstatus vom aufgeklärten Diskurs ausgeschlossen sind, der in ihm erst hergestellt wird. [13]
Freilich wäre einzuwenden, dass Satire traditionell auch ein Mittel der Kritik an Obrigkeit ist. In nicht-pluralistischen Gesellschaften kann sie durchaus politisch wirken in der Bloßstellung der Mächtigen, als uneigentliches Ansprechen von Missständen, als Verbreitungsmedium von Informationen und vor allem in der Stiftung eines gemeinsamen Resonanzraumes für ein auch sinnlich vermitteltes Dagegensein (eben das Gelächter). In pluralistischen Gesellschaften verliert sie diese konspirative und im guten Sinne aufklärerische Funktion, hier ist sie ein kulturelles Angebot unter vielen, das sich von der Notwendigkeit zur Zielgruppendiversifikation getrieben immer schon an ein ganz bestimmtes Publikumssegment richtet. Entsprechend bleiben ihre Informationen tautologisch – so gehörte es zu den Hauptanliegen des politischen Kabaretts der 80er, dass Helmut Kohl gerne Saumagen isst, angeblich wie eine Birne aussähe (die Erfindung einer weiteren komplett überflüssigen Zunft: der KarikaturistInnen) sowie die spezifische an Aphasie heranreichende Täppischkeit pfälzischer Aussprache – weniger aber die reaktionären Inhalte seiner Politik. Dabei waren die Pointen zumeist unglaublich scheiße und entgegen dem Selbstbild des Publikums als anspruchsvolles völlig pennälerhaft – die Möhre des Häschenwitzes war sozusagen als Kohl relauncht worden. Kurz, jene Subversion, bei der einer/m laut kostenlosen Stadtmagazinen angeblich immer "das Lachen im Halse stecken bleibt", war ein komischer Methodenmix aus Schulhof-Hänselei und folgenloser (nämlich personalisierter und damit harmlos gemachter) Herrschaftskritik – wie RAF, nur bestuhlt. Sozusagen eine Satire auf die systemstabilisierende Funktion von Satire findet sich in dem zu Unrecht als Klassiker des Pro7-Humors gehandelten, vielmehr politischsten [14] Monty Python-Film The Life of Brian: anstelle Pilatus zwecks Begnadigung den Namen eines zum Tode Verurteilten zu nennen, amüsiert die Menge sich bloß mit dessen Sprachfehler durch Zuruf sprachfehlerrelevanter Namen.
Meine These ist nun, dass Satire der geschichtlichen Formation der Disziplinargesellschaft zugehört. Deren Denken und Ideologie repräsentiert sie im Feld des Humors. Sie steht eben nicht "auf der Seite der Schwachen" – eine klischierte, "am Wesen des Gegenstandes seltsam vorbeimenschelnde Definition" [15] , sondern schlägt sich vielmehr auf die Seite derjenigen, die zu wissen glauben, was für "die Schwachen" gut ist.
Wo Satire noch einem traditionellen (d.i. liberalen) Liberalismus entspricht, ist Comedy quasi Neoliberalismus in Humorform und kann gattungsgeschichtlich als kontrollgesellschaftliches Update von Satire betrachtet werden, die logische Fusion aus Feyerabends "Anything goes" und dem "Anything must go" des globalisierten Kapitalismus zum zynischen "Anything must goes" der "Stahlbademeister" [16] Raab, Harald Schmidt, Niels Ruf etc. Erlaubt ist hier, was der Einschalt-Quote gefällt.
Der sicherlich kritikwürdige und salopp-verkürzte Schematismus dieses Modells sollte dabei nicht dasjenige überdecken, was an ihm geeignet scheint, Humortypen mit ihrem ökonomisch-sozialen Bedingungsrahmen im Sinne einer ideologiekritischen Humortheoriebildung kurzzuschließen und Humor – im Sinne der These, ihn als Kettenglied der gesellschaftlichen Sinnproduktion aufzufassen – als Ort für Ideologiebildung, aber auch -kritik beschreibbar zu machen. Der sich hierbei aufdrängende Befund, dass "Humor" faktisch häufiger rechts steht, als man/frau/sonstige kraft der üblichen Phrasen vom prinzipiell anarchischen Lachen annehmen möchte, sollte gerade nicht daran hindern, auch die dekonstruktionistisch-subversiven Potentiale von Humor zu erkennen und zu erörtern.
Wer mit Comedy zu tun kriegt, wird sofort zum Objekt eines Ausbeutungsverhältnisses gemacht, aus dem so lange und unnachhaltig Humorkapital geschlagen wird, bis er/sie zusammenbricht wie ganz real im Falle der "Maschendrahtzaun-Frau" Regina Ziegler, die im Rahmen der von Stefan Raab angezettelten und mit vorbildlicher Effizienz bis zur Beate Uhse-Schaufenstergestaltung meiner Heimatstadt abgewickelten Sächs-Ploitation dann einen Nervenzusammenbruch erlitt.
Statt als kritische Instanz versteht sich Comedy nur noch als Dienstleistungsunternehmen, orientiert sich auf die Bedürfnisse spezifischer Publikumsschichten, auch wenn diese Schichten eher freischwebende, fiktionale Gebilde darstellen und keinesfalls deckungsgleich sind mit ihren sozialen Pendants. Die hier sowohl Sprachrohr- als auch Thematisierungsfunktion erfüllenden Sender zielen nämlich mit ihrem pseudo-postmodern zwischen Zitat und Authentizität schwankendem Proletkult-Gemisch aus Wet T-Shirt-Contest-auf-Mallorca-Reportagen, ausländische SozialbetrügerInnen-Enthüllungsjournalismus, Talk-Freak-Shows, "Die dümmsten Wohlstandsverlierer"-Formaten und eben dem Halli-Galli-Drecksau-Humor von Comedy ebenso auf eine Neue Mitte ab wie auf eine traditionelle Arbeiter- und Unterschicht. Symbolisch für diesen Schulterschluß mag die große Integrationsgestalt eines Harald Schmidt stehen, der seine ZuschauerInnen quer durch die Bildungs-Schichtungen zur informierten 80er-Jahre-Zynismus-Community verklammert.
Informiert vor allem dahingehend, als dass Material dieses Humors zu einem guten Teil dem Bereich reaktionärer Klischees entnommen ist; kaum wird dem Publikum mal etwas vorgesetzt, was mit dessen Horizont kollidieren könnte. Was Comedy thematisiert – darin besteht der Dienstleistungsethos – muss allgemein bekannt und schnell begreifbar sein. Ähnlich arbeitet auch der jungdeutsche Film, dessen Versuch, tarantinomäßig mit coolem Wissen zu hantieren von der gleichzeitigen hysterischen Angst durchkreuzt wird, ob es auch wirklich von der Gesamtheit der anvisierten Zielgruppe problem- und rückstandslos verstanden werden kann. Deswegen finden sich in beiden Fällen Minderheiten von der nicht-zwangsheterosexuellen Lebensform bis zum Nicht-Deutschen in der Regel nur als die PointengeberInnen ihrer einschlägigen Klischees wieder: so müssen z.B. MigrantInnenkinder-Darstellungen in Comedy-Sketchen spätestens nach 5 Sekunden "Voll krass, ey Alter!" sagen, um erkennbar zu bleiben. (Ob spezifisch migrantische Comedy-Formate wie Erkan und Stefan es schaffen, damit signifyingmäßig zu spielen, soll jemand beurteilen, der/die diese Fadesse länger als 2 Sekunden ungezappt aushält.)
Unter dem Deckmantel aufgeklärter (Herrschafts-) Kritik gehör(t)en Rassismus und Sexismus freilich bereits zum Repertoire des politischen Kabaretts, etwa wenn der Kabarettist Christoph Sommer über Angela Merkel sagen darf, man sehe ihr schon von weitem an, "dass ihr nichts von allein in den Schoß fällt" – bei soviel Stammtischniveau bleibt mir allerdings dann tatsächlich doch noch das Lachen im Halse stecken.
Appelliert wird dabei an das, was die kurzlebige Toleranz-Disziplinargesellschaft der 80er aus dem öffentlichen Diskurs in den Status kultureller Latenz abgedrängt hatte. Von dessen Toleranz-Ideologie hat Comedy sich vollends entfesselt, ja sie macht diese und v.a. den Interventionismus der p.c.-Bewegung gezielt zu ihrem Figurenarsenal (als Sozpäds, Gutmenschen, Softis – auch diese Tradition ist vom politischen Kabarett ererbt, wo es zwischen zwei Kohl-Nummern immer eine grün-alternative Diskussions-Kultur-Nummer gab).
Anarchisch ist dieser Humor nur im Sinne des neoliberalen Missverständnisses "Anarcho-Kapitalismus", ja, seine Entgrenzung ist ähnlich derjenigen, die in Swinger-Clubs angeboten wird [17] . Die inszenierte Transgression, wie sie v.a. in Personality-Comedy-Shows teils ganz handgreiflich durchschlägt, richtet sich als Regelverstoß nur gegen ganz bestimmte Regeln, während sich die anarchische Praxis Helge Schneiders z.B. gegen ökonomische Regeln richtet [18] . Denn: Welche Regel verletzt Harlad Schmidt eigentlich, wenn er z.B. einem als Talkgast geladenen Model zur Begrüßung ganz spontan an die Brust greift? Die des Aufklärers Freiherr Adolf von Knigge wohl sicherlich, mag sein auch diejenige des in öffentlich-rechtlicher Betulichkeit vor sich hin dösenden TV-Betriebs von vor 15 Jahren, als Nina Hagens angedeutetes Masturbieren noch Köpfe zum Rollen bringen konnte. (Wobei natürlich auch damals schon das Geschlecht des/der mit aggressiven sexuellen Gesten Aufwartenden eine entscheidende Rolle spielte). Da das hierbei gebrochene Tabu spätestens mit der Einführung des Privatfernsehens gegangen worden ist (auch wenn manche empörte TV-Anstands-Wauwaus noch gar nicht gemerkt haben, dass es sie gar nicht mehr gibt), handelt es sich hierbei wohl eher um eine Grabschändung als um einen tatsächlichen Tabubruch. Das Regelwerk der Disziplinargesellschaft (Wohlanständigkeit) wird hier gleichsam in neoliberaler Perspektive gebrochen (Quote), zudem das männliche Subjekt, das sich beim weiblichen Objekt bedient, die Bestätigung einer viel robusteren und beschisseneren Regel ist und Macht bestätigt, anstatt ihren Systemen interessante Kurzschlüsse zuzufügen.
Dass trotzdem immer noch gerne behauptet wird, Schmidt gelinge es manchmal, dem Medium, in dem er sich bewegt, einen Spiegel vorzuhalten [19] – was auch immer das jetzt medientheoretisch heißen soll (als wäre das Sich-den-Spiegel-Vorhalten nicht die einzige Beschäftigung von "Medien") –, bestätigt nur das Funktionieren jenes kalkulierten double bind, mit dem er arbeitet: Schmidt beherrscht nämlich jene zweideutige Sprechweise meisterlich, die sich gezielt an zwei verschiedene Publika, deren Erwartungshaltungen und Denkweisen richtet. Die Zwangslogik mit der bei ihm dem Begriff "Polen" der Begriff "Autodiebstahl" folgt, lässt sich vom aufgeklärten StudienrätInnenanteil als satirische Zuspitzung decodieren, während es der andere Teil als lustig gewendete, aber prinzipiell eins-zu-eins funktionierende Thematisierung des Realen nimmt. Diese Strategie ist so subversiv, dass Harald Schmidt es sich heute leisten kann, aufzuhören, wann er will, wie er vor einiger Zeit bei irgendeiner Gelegenheit beteuerte.
Da beide Pole ohnehin nicht säuberlich voneinander zu scheiden sind und in einer von der Omnipräsenz rassistischer Diskurse geprägten Gesellschaft die Beteuerung, man/frau/sonstige denke nicht rassistisch (analog: sexistisch) in erster Linie als Weigerung verstanden werden muss, sich mit den Einschreibungen rassistischer Denknormen ins eigene Bewusstsein auseinander zu setzen, bleibt eine solche Aufklärungsarbeit ohnehin tautologisch. Zumal selbst die satirische Überhöhung in ihrer permanenten Thematisierungsleistung des Komplexes "Polen-Autodiebstahl" ja an einem gesellschaftlichen Klima mitwebt, in dem eben solche Stereotypen "ganz normal" werden [20] . Wer in Polen nicht genau darauf achtet, wo er sein Auto abstellt, werfe den ersten Stein.
Adorno hat einmal sinngemäß gesagt, "Fun" würde gesellschaftlichen Sinn immer bloß unter dem Deckmantel einer scheinbaren Sinnfreiheit wiederholen. In diesem Sinne gibt sich der gesellschaftliche Sinn in den individualanarchistischen Aufgipfelungen, mit denen Comedy einem angeblich aus der Adenauerära herübergebeamten gesellschaftlichen Bierernst die Stirn und den Max Stirner bieten zu müssen meint, im leicht punkigen Outfit zu erkennen. Er erscheint aber gerade dadurch so unverrückbar und totalitär, dass er nach Anarchie erst deshalb aussehen kann – Sie müssen die neo-adornide Denk- und Satzstellung verzeihen –, weil kein Zustand außer ihm überhaupt mehr gedacht, geschweige den formuliert werden kann.
Die flachen Hierarchien von Comedy sind also ungefähr so subversiv wie kiffende FDP-WählerInnen. Nicht von ungefähr ergibt sich ein Guido Westerwelle seinem Schicksal, und lässt sich zu Stefan Raab einladen – der ihn dann auch gleich pflichtschuldig bauchpinselnd demontiert, Schwulengewitzel inklusive – nachdem er bereits im Big Brother-Haus klar gemacht hat, dass er gar nicht so langweilig ist wie sein Parteiprogramm. Westerwelle weiß nämlich ganz genau, wem er sich da anbiedert, indem er zeigt, dass er zwar weniger Spaß, dafür aber umso mehr "Spaßgesellschaft" versteht.
"Es bleibt nichts im Halse stecken" [21]
Mindestens seit Helge Schneider qua Katzeklo ein Millionenpublikum erreicht und zu einem kolossalen Missverständnis herausgefordert hat, ist er zum beliebten Studiogast geworden. Seine Medien-Appearances sind dabei gekennzeichnet von einer Weigerung, sich den eingespielten Abläufen zu unterwerfen, ähnlich wie man/frau/sonstige es von seinen Bühnenshows kennt, dies jedoch in einer komplett anderen Weise als bei der BerufsverweigererInnen-Riege, die die Störung nur als symbolkapitalistisches Mobbing, als Bloßstellung des Gegenüber und damit als Bestätigung des gesellschaftlichen Konkurrenzdruckes inszenieren kann [22] . Während derlei im System verbleibt und nach dessen Regeln spielt, verlässt Schneider dieses System, das nicht verlassen werden kann, indem er sich sozusagen nomadisch darin umherbewegt, d.h. ihm andere Bedeutungsmuster und Bewegungslinien einschreibt. Dem medial eingeklagten Identitäts-Prinzip (qua dem sich z.B. Raab als Provo inszeniert) verweigert er sich durch einen fortlaufenden Identitäts-Drift, womit es ihm tendenziell gelingt, seine Präsenz ungreifbar zu halten: Ähnlich dem Schauspieler in Woody Allens Deconstructing Harry kriegt man/frau/sonstige ihn nicht scharf. Die mediale Strategie der sprunghaften Produktion einer unendlichen Kette an Helge Schneider-Identitäten habe ich bereits anderswo ausführlicher beschrieben und mit der These verknüpft, Helge Schneider nähere sich dem Material seiner Arbeit (sei dieses nun "Massenpublikum", Autorenfilm, Kriminalliteratur, Love me tender, Fernsehen, Autobiographie oder die Schilderung einer Polarexpedition mit Reinhold Messner) als Jazzmusiker [23] . Was Schneider unternimmt, bespielt er zugleich mit jener Wucht, die Jazz hatte, bevor er Bildungsgut und Brauchtumspflege wurde. Ähnlich wie der Interpretationsbegriff des Jazz den Jazzklassiker nicht zerstört, annektiert oder kolonialisiert, indem dieser interpretiert wird, sondern aus seinem kryotechnischen Klassikerelend erlöst, ist Schneiders Humor kaum je zerstörerisch oder annektierend. Obwohl er ja allein pointentechnisch so ziemlich jedem Phänomen der deutschen Fernsehlandschaft haushoch überlegen ist, benutzt er diese Überlegenheit in Fernsehshows nicht dazu, sein Gegenüber plattzumachen und zum Ablachen frei zugeben, wie dies Stefan Raab programmatisch tun muss. Eher eröffnet Schneider gewissermaßen Jam-Sessions, die natürlich nicht funktionieren können, da ihre Umgebungen Umgebungen der Macht sind, aber gerade dieses Nicht-Funktionieren erzeugt jenen dekonstruktionistischen Grundsound, der außer, dass er wirklich funky ist, auch einiges darüber erzählt, was an den Umgebungen, in denen er so grandios und bombastisch scheitert, nicht stimmt.
Sein auf den ersten Blick infantil anmutender Unernst zeigt sich gerade als Spiel mit und gegen die Gerinnungsfaktoren und -geschwindigkeiten seines Materials, eine ihren Inhalten nach nicht primär politische Intervention gegen das gewordene, fertige Produkt als Ideologie von Kapitalismus, bürgerlicher Gesellschaft und abendländischem Denken sowie deren hermeneutischem Prinzip.
Der Begriff der "Improvisation" wird von Schneider selbst als Grundlagenbegriff seiner Arbeitsweise beharrlich ins Spiel gebracht. Dabei erscheint dieser von gefährlicher Nähe zu neoliberalistischen Einpeitschungen: Innovation, Flexibilisierung, Marktdynamik, Leistungsorientierung swingen hier mit. Allerdings sind diese Begriffe aufgehängt im Paradigma eines Marktes, in dessen Hoheitsgebiet das Innovatorische immer nur als Waren-Dienstleistungs-Selbstidentität die Bühne betreten kann. Die angeblich enormen Geschwindigkeiten postmoderner Märkte sind jedoch nur relative Geschwindigkeiten, denen Helge Schneider – man/frau/sonstige verzeihe den Jargon – eine andere, "absolute" entgegensetzt: der Begriff der Ware wird gerade in der Unstetigkeit und Sprunghaftigkeit der Produktion exekutiert. Von daher stellt es auch ein grobes Missverständnis dar, dem auch z.B. Seidel aufsitzt [24] , wollte man/frau/sonstige dieses Werk nach "gelungen"/"nicht-gelungen"-Kategorien, nach innovatorischen und selbst-plagiativen Abschnitten unterteilen: denn darauf kommt es bei Schneider ja gerade nicht an, sich als wild um sich schlagende Innovationsmaschine einer bürgerlichen Konsum- und Geschichtslogik zu unterwerfen. (Was nicht heißen soll, dass Schneiders improvisatorische Leistungen nicht schier menschenunmöglich sind, wie ein Vergleich mit ähnlichen Projekten zeigt – etwa BOBBY CONN als Mischung aus Helge Schneider, MC 5, Prince und einem vor der Wohnungstür stehenden Zeugen Jehovas-Pärchen.)
Dass bei Schneider Albernheit nicht nur debile Enthemmung oder eskapistische Regression ist, Nonsens nicht nur schlechtdurchdachte Verweigerung von Sinn meint (obwohl – und das ist nicht nur deshalb wichtig, um bestimmte links-humanistische Klischees von der Bettkante zu stoßen – es das eben mit vollem Recht auch ist), hat Seidel bereits herausgearbeitet. Wichtig wäre, "den kynischen Impuls zu bemerken und dessen Differenz vom zynischen Malström, der bis heute einen Großteil der politischen, öffentlichen, medialen Welt aufgesaugt hat, aufzuzeigen." [25] Denn: "Nur vom Kynismus her läßt sich der Zynismus eindämmen, nicht von der Moral her." [26]
In der spezifischen Art der Produktion, Reflektion und Zirkulation von Sinn hat Schneider eine Methode entwickelt, wie dessen gesellschaftliche Produktionsweise gestört werden kann, nicht um die Produktion gänzlich zu stoppen, was unmöglich wäre, sondern um das Produzieren seinem Zweck zu entziehen. Schneider stellt – da wo Comedy den von der Satire ererbten Familienbetrieb nur kaltschnäuzig modernisiert, in dem es ihm ein wenig anti-verkrustete Deregulation injiziert – einen Überschuss, ein Zuviel an Sinn her, das sich nicht mehr sinnvoll auf den konventionalisierten Sinn des gesunden Menschen und seiner überschätzten Verstandestätigkeit abbilden lässt. Dies stellt es als "Sinnlosigkeit" eine Wiedergewinnung von Sinn dar, indem durch das Nichts-Bedeuten, das Leckschlagen der Bedeutungszirkulation, die Paradoxien, den Rückfall in vorsprachliches Rauschen als Verweigerung einer immer schon so funktionierenden Sinnproduktion ja erst der Platz geschaffen wird für eine andere und neue. Denn, dass etwas gar nichts bedeutet, heißt ja, dass es wieder alles bedeuten kann (ähnlich der bekannten "Abschaffung des Privateigentums"). Wo ein Sinn offensichtlich fehlt, muss er entweder aktiv hergestellt werden oder man/frau/sonstige belässt es dabei, dann wäre das Nicht-Vorhandensein von Sinn der einzige Sinn des "Sinnlosen".
Die Unsinnsfelder, die Helge Schneider anlegt, sind mit Sinn wie vermint: tritt man/frau/sonstige etwas zu lange und zu heftig auf die falsche Stelle wird man schier zerrissen von der semantischen Wucht einzelner zunächst für unsinnig geglaubter Passagen.
Entsprechend ließe sich über einzelne Sätze und Wortkonstellationen abendfüllend sprechen, wozu man/frau/sonstige sie nur (und das wäre dann aber schon wieder verfälschend) aus den Kaskaden ihrer Erzeugng herauszulösen bräuchte. Ein Beispiel gibt die erkenntnistheoretische Verheederung und Neuverschraubung der positivistischen "Erde" und der radikalkonstruktivistischen "Welt" zur "Werde" nicht nur als Ur-Imperativ einer göttlichen creatio ex nihilo, sondern auch der heraklitheischen-nietzscheanischen-bergsonschen-deleuzianischen/guattarischen Philosophie-Tradition, die sich ... (Fragment)
Derartige ins Brodelnde des Schneiderschen "Sinns" gerichtete Scheinwerferkegel sollten allerdings nicht im Sinne der Installation einer "gültigen Lesart" verstanden werden, sondern nur darauf verweisen, wieviel Bedeutung aus dem scheinbaren Unsinn gemolken werden kann und wie anschlussfähig dieser sich in die unterschiedlichsten (wenngleich doch nicht in alle) Richtungen zeigt. Wer die Vielheit Schneiderscher Texte in Interpretationseinheiten zu zerreißen versucht, sie bloß für tollkühne Metaphern (in irgendwie fliegenden Kisten) erklärt, bringt unweigerlich ihre Fließgeschwindigkeiten, die dann allererst mitzuinterpretieren wären, zum Versiegen. Diese aber sind u.a. gerade wichtig dafür, dass Schneiders Werk nicht gänzlich (wie andere Erscheinungsformen der Avantgarde) im Schwierigen, Komplexen aufgeht und sich soweit verdunkelt, dass nur noch Diskurs-AbonehmerInnen sich darin zurecht finden. Ihrem monströsen Kunstcharakter wird eine ganz basale und erfrischend banale Lustigkeit entgegengestellt – hier wird kein Rachenrohrkrepierer, "kein Lachen erzeugt, das im Halse stecken bleibt, sondern ein gesundes, herzhaftes Lachen" [27] , bei dem nicht mal Kleinkinder ausgegrenzt werden. Wer will, kann sich auch einfach nur in die Hose pissen vor Erschütterung.
Helge Schneider als französischer Philosoph? Die Quadratur der Themenkreise
Die Arten und Weisen der Erzeugung eines "Unsinns" bestehen bei Helge Schneider nicht darin, einem geschlossenen Sinnsystem ein geschlossenes Unsinnssystem entgegenzusetzen, wie in der Unsinnspoetik des noch polaristischem Denken verhafteten Dadaismus. Vielmehr scheinen beide Systeme ihre Schleusen zu öffnen, um sich zu merkwürdigen Schorlen zu verquirlen. Sinn und Unsinn, wenn man/frau/sonstige diese beiden Großkategorien einmal als Orientierungspfähle beibehält, sind bei Helge Schneider fast ununterscheidbar und jedenfalls nicht mehr voneinander ablösbar geworden.
Dies zeigt sich z.B. in den "spontanen Bühnenerzählungen", jenen oft wuchernden und selbstläuferhaften Texten, die in Form von Livemitschnitten dann ihren Weg auf die Platten finden. Stehen sie noch in der Tradition der Überleitung, der (erläuternden) Ansage, der Bühnenkommunikation, des charismatischen Geplauders, so handelt es sich doch um eine äußerst komplex-gebaute und komplett eigenweltliche Erzähltechnik, die höchstens noch an Lewis Carroll, Franz Kafka und die Prosaarbeiten von Kurt Schwitters erinnert.
Schneider improvisiert hier um ein mehr oder weniger festgelegtes Grundgerüst herum, dass sich aber beliebig erweitern, brechen und als Absprungfläche in ganz andere Gefilde nutzen lässt. Zwischen hochgradig identischen Versionen und unendlicher Abweichung ist alles möglich. Selten sind sie als ganzes völlig "unsinnig", sondern häufig konventionell angelegte Schilderungen, Erzählungen oder Reflexionen, in deren Vollzug aber ständig und poltergeistphänomenologisch destruktive Stimmen einbrechen. Der Text, der doch erkennbar ein Text über etwas bleibt, ist weder in seiner grammatikalischen Struktur (Sprache) noch in seiner narrativen Logik (Geschichte) noch dem Modus seiner Präsentation (Vortrag) in jener Weise intakt, in der sich Texte für gewöhnlich (selbst noch als "experimentelle") für die Bruchlosigkeit und Funktionabilität ein grundsätzlich unproblematischen und vor allem auch erzählerisch handhabbaren Modells von "Realität" und deren sprachlicher Kohärenz verbürgen.
Obwohl er permanent "Sinn" ausstößt, ist dieser "Unsinn" keine Poetifizierung, kein Versuch, das so Nicht-Sagbare durch die Auflösung von sprachlichen Begrenzungen wiederum erzählbar zu machen und auch nicht das Quengeln eines Verstummens vor dem Realen (wie in Adornos Verständnis des Sich-Ausschweigens moderner Kunstwerke).
Thematisch kreist dieses Erzählen häufig um einen bestimmten Zustand von Welt: in Schneiders Texten begegnet oft eine ominöse und vollends unmotiviert aufflammende splatterhafte Gewalt, bei der sich tiefe Abgründe zwischen Ursache und Wirkung geschoben haben, etwa wenn der Vater in Pubertät seine Tochter "brutal, krankenhausreif zusammenschlägt" [28] , anscheinend wegen eines Mofaunfalls. Der Erzähler findet das "selbstverständlich [...] und auch mehr als verständlich" – ob im hermeneutischen oder im zwischenmenschlichen Sinne bleibt unklar. Ebenso hinterlässt Komissar Schneider, Schneiders Protagonist mehrer Kriminalromane und eines Filmes, beim Ermitteln eine Spur aus natürlich folgenlos bleibenden Eigentums- und Gewalt-Delikten. Die Präsenz von Brutalität, Elend, Krankheit und Tod [29] erinnert nicht nur an ein mariginalisiertes Schicksal im Spätkapitalismus, sondern auch an das spätkapitalistische Schicksal der Marginalisierten. Explizit angesprochen wird dies in der Vorrede zu Ladiladiho: "Es ist eine Welt des Horrors, der Qualen und des Entsetzens. Meine Lieder spielen in dieser Welt und machen alles wieder gut." [30]
Hier wird – wie auch immer ironisch fraktalisiert – noch einmal an das Versöhnende der Kunst erinnert, womit allerdings weniger die Harmonisierung des Häßlichen und Disparaten zu stimmiger und sinnstiftender höheren Einheit gemeint sein dürfte, wie sie als Leitidee der klassischen Ästhetik vorschwebt, als vielmehr das Tröstliche, Solidarität stiftende, wie es in manchen Momenten manche Popstücke hinkriegen.
Aber Schneider verweist hier auch auf die konstruktivistische Sprengkraft seiner Ästhetik. Ähnlich der rhizomatischen Erzählweise Kafkas [31] , die gerne zu Unrecht mit Bürokratismus-Phobie und existenzialer Not verwechselt wird (oder der Star Trek-Folge, in der Whorf einen Riss im Quantenraum erzeugt), befindet sich die erzählte Welt in permanenter Veränderung, sie wandelt sich nicht nur innerhalb ihres Weltmodells, sondern die Weltmodelle scheinen überhaupt ständig ineinander zu stürzen. Die Außerkraftsetzung von Naturgesetzmäßigkeiten, die Inkonsistenz der Kategorien "Zeit" [32] und "Raum" sowie ihres Zusammenhangs [33] , der Wechsel der Erzählgeschwindigkeiten vom Vortrags-Stakkato über eine Der Schatten des Körpers des Kutschers-mäßige Gedehntheit [34] bis zum Verfangen in Endlosschleifen [35] , die an die Zahlenphantastik des Nibelungenliedes gemahnenden Zahlen- und Größenangaben [36] – all das verweist darauf, dass diese Welt nicht einfach abgeschildert ist (wie immerhin in ca. 99,99% aller Texte incl. phantastische, groteske und Science Fiction [37] -Literatur), sondern sich entlang des geschilderten Ereignisses ständig neu konstituiert. Die in die Konventionen des Realen getriebenen Brüche, Verschiebungen und "Intensivierungen" sind in sich jedoch ebenso wenig stringent und ergeben zusammengenommen – weder im jeweiligen Text, noch in größeren Werkeinheiten – ein konsistentes Bild, eine in sich geschlossene "parallele Welt" (wie im Fantasy- oder dem Alternativwelt-Genre).
Dies zeigt sich besonders stark und hier auch schon leicht beklemmend in den Filmen Praxis Doktor Hasenbein und Jagd auf Nihil Baxter, die erneut an die historisch, sozial und geographisch sich stets entziehenden Szenarien Kafkas denken lassen – jene eigenartige Differenz von Kafkas Handlungsorten zum "realen" Prag oder Amerika. Letzterer spielt in einer nahen Zukunft, die aber wie dem experimentellen französischen Film der 60er entnommen wirkt und sowohl Platz hat für knallharte Ruhrgebietsrealistik als auch für Louis de Funès-Slapstick evozierende Gendarmen-Uniformen. Das Wo, Wie und Warum des Filmes ist ebenso ausgeklammert wie in Praxis Doktor Hasenbein, einem klaustrophobischen Kleinstadtmelodram um den Arzt Doktor Angelika Hasenbein, dessen fast gesamte Spieldauer sich darin genügt, das seltsame Alltagsgeschehen in dem Ort Karges Loch zu erzählen, über den wir nur per Bühnenbild erfahren, dass er am Ende eines riesigen Tunnels liegt (der Tunnelausgang ist freilich nur eine monströse Filmkulisse aus Pappmaché!). Neben dem stockfleckigen Interieur einer "Vergangenheit" (Krämerladen, Hausierer-Käseverkauf vom Bollerwagen aus) gibt es allerdings schon einen Geldautomaten und die Länge der Geheimzahl von Doktor Hasenbein lässt auf apokalyptische Überbevölkerung schließen. All dies ergibt kein stimmiges Bild einer bestimmten, erzählten Zeit, eher scheint diese eine Verschlingung verschiedener Zeitschichten zu einem unentwirrbaren Knäuel [38] zu sein.
Der Krieg, der dann als unfassbare Last Minute-Handlung schicksalhaft in das Leben des Arztes einbricht und ihn nach 40 Jahren in einem U-Boot als Heimkehrer in ein schwach modernisiertes Ortsbild Draußen vor der Tür-mäßig abblitzen lässt, ist weder der letzte noch der nächste und auch nicht die platonische Idee davon, weder Heideggers Geworfensein noch jene expressive Geste aus der Pubertäts-Ploitation The Wall. Und doch irgendwie das alles und noch vielmehr als furiose Stampede der Zeichen. Das Vertrautheits-Fremdheits-Gemisch dieser Orte mag an Dystopien erinnern wie sie sich bei Alfred Kubin (Die andere Seite) und Hermann Kasack (Stadt hinter dem Strom) beschrieben finden, doch im Unterschied zu dort haben Schneiders Orte keinen parabolischen Gehalt mehr, sie lassen sich nicht mehr interpretativ erhellen, was über sie gesagt werden kann, fügt sich nicht mehr stimmig zueinander. Ähnlich sind die Rollen seiner Filme besetzt, wo Frauen von Männern (kaum allerdings Männer von Frauen!) gespielt werden und Kinder von Erwachsenen, was eine vulgäre Komik und existenzielle Drastik abwirft.
Dies sind einige wenige Beispiele für eine in der Fülle ihrer Effekte kaum je erschöpfend beschreibbare Überblendungstechnik, mit der Genderkategorien ebenso aufeinanderprojiziert werden wie wiedererkennbare historische, soziale und geographische Topographien auf eine generelle Atopie (eine Ortlosigkeit, die weder Utopie noch Dystopie ist). Auch mit Begriffen wie "absurd" oder "grotesk" ist dieses Fremdartige nicht noch einmal in eine geordnete Verhältnismäßigkeit zu bannen, da diese nur Verzerrungen und Abweichungen vom "Normalen" markieren und peripherisieren, das "Normale" eben durch die Form und Art der Verzeichnung bestätigen sollen. Sie sind vielleicht wie das Paris der SituationistInnen nur noch mit dem Stadtplan von London begehbar. Somit wird ein unendlicher Möglichkeitsraum eröffnet, indem Bedeutungen zwar laufend hergestellt, aber zugleich auch durchschritten und durchschnitten werden, sie haben nur Bestand für die Dauer eines Wortes, eines Satzes, eines Tones. Seidel sieht hierin ein rhizomatisches Verfahren:
"Bei Schneider äußert sich das nicht nur in der Vielfalt der Themen, der Medien, der Stile, der Art – wiewohl das alles aussagekräftige rhizomatische Indikatoren sind, er erreicht es darüber hinaus durch eben jenen >>Wettstreit von Dialekten, Mundarten, Jargons und Fachsprachen<< und deren verschiedensten (parodistischen, satirischen, ironischen, nonsensikalischen, plagiierenden...) Inszenierungen und diese unnachahmliche Vieldeutigkeit, die aus der Kunst entsteht, eine präzise, genaue Ungenauigkeit sprachlich-literarisch herzustellen. Dieses quasi-systematische Verfehlen eines Aussagesinns (oder einer Aussageform), der durch seine Absenz unmittelbar und eindringlich präsent ist und der zudem einen weitgefächerten assoziativen Raum voller möglicher Bedeutungen eröffnet, ist sicherlich eine der wesentlichsten Stärken. So kann nur jemand sprechen, der das postmoderne Dilemma des Sprechens begriffen hat." [39]
Dass nun eine modische Begriffskollektion aus "Deterritorialisierung", "Nomadologie", "Werden", "Schaft" und das aufgrund von Omnipräsenz schon ein wenig falbe "Rhizom" nicht völlig aus dem lauen Lüftchen ihrer derzeitigen Penetranszendalität gegriffen sind, zeigt sich in den Themen Helge Schneiders, so z.B. in dem in zahlreichen Varianten vorhandenen Stück Videoklip [40] . Hier erzählt Schneider ein Video zu einem seiner Stücke als präzise Persiflage auf Videos wie man/frau/sonstige sie z.B. von Peter Gabriel kennt. Ausdruckstänzelndes Gemorphe und sonstige pseudo-symbolistische Effekthascherei werden allerdings durch eine krude Alltagsmaterialität erweitert: in einer Version fliegt die Band in einen Pfannkuchen eingerollt durch das All, in einer anderen muss sie sich "an den Säcken von alten Männern" [41] über eine Schlucht hangeln. (Das schwächste Glied in dieser Scrotum-Kette ist natürlich dasjenige von Schneiders Schlagzeuger Peter Thoms, der die Machtverhältnisse moderner Arbeitswelten in Running-Gag-Form thematisiert). Das "Geschissene" solcher Bildmaterialschlachten wird wiederum in einer anderen Version ganz plastisch ins Bild gesetzt als Elefantenkot, den Thoms mit einer Schubkarre auffangen muss. Und natürlich taucht auch (als Zeichen für das Musikvideos innewohnende Emanzipationspotential wie auch für dessen Problematik und die geschlechtlichen Ausbeutungsverhältnisse der Musikvideo-Ikonographie – diesbezügliche Stellen wurden im Zitat mit [!] markiert) in den verschiedenen Versionen gelegentlich Madonna auf:
"Madonna kommt auch da unten runter. Und auch wieder Sexualität. Sie spielt dann ein bißchen damit, mit Madonna. Die hat so eine ganz hautenge Ledergarnitur an, und wir sitzen dann darauf, den ganzen Abend und lesen Zeitung[!]. Und dann wird das so ein bißchen langweilig[!], aber das soll auch so sein[!]." [42]
Indem Helge Schneider allerdings dieses Video nur erzählt (und immer wieder anders erzählt), anstatt es und das in ihm dann bloß dargestellte Prinzip der Transversalität tatsächlich zu einem Produkt zu verdinglichen [43] (in einer Version heißt der Text dann auch Videoprodukt) wird es gerade da gerettet, wo es sonst nur als Klischee seiner selbst – als Peter Gabriel-Video – existieren kann. Eine besonders wuchernde Version endet entsprechend mit der Einschränkung: "Das sind die ersten 2,3 Sekunden, den Rest machen wir noch." [44]
Ebenso lassen sich immer wieder Stellen aufzeigen, die wie selbstverständlich philosophische Probleme behandeln (wenngleich diese sogleich wieder von den Bewegungsformen der Texte untergepflügt werden, was für ihre Rezeption von entscheidender Bedeutung sein sollte) – und zwar: akademisch-philosophische Probleme! In den Stücken des Philosophie-Werk-Komplexes wird z.B. ein Feuerwerk an erkenntnistheoretischen ("Sind wir nicht sogar Messungen?"), sprachphilosophischen ("Ist unser Leben denn mehr als eine ananananandergereihte Reihe") und transzendenzphilosophischen ("Sind wir nicht entstanden aus etwas ganz Bestimmtem?") Fragestellungen abgefackelt, um schließlich in deformierter Spruch- und Binsenweisheit zu veröden ("Wir müssen noch lernen – lernen, lernen, lernen – popernen!") [45] .
Am interessantesten ist dabei wohl jene Passage, die als Scheitern von Transzendenz einen Übergang von theoretischer zu praktischer Philosophie markiert, wenn nämlich die Kuschelrock-CD-haftigkeit der existenzialphilosophischen Phraseologie des noch halbwegs vernünftig formulierten und moderat vorgetragenen Einstiegs ("Wer sind wir – wo kommen wir her?") von dem ansatzlos hervorgeschleuderten Sprachklumpen "Wer seid das ihr/Ihr [?]" abgestochen wird. Schneider klingt hier wie ein von Laienhand aus der Klarinette gequetschter Ton. Wie hier ein in seiner warenförmigen Subjekthaftigkeit weggesperrtes "Ich" seinem durch Einschaltung des neutralen Artikels in ein monolithisches "Ihr" (das "Ihr" ist ja eine in der Philosophie gerne vernachlässigte Kategorie) ineinsgestauchten Gegenüber aus dem unangenehmen Vollrausch fundamentaler Einsamkeit die Frage nach dessen ontologischem Status vor die Füße kotzt, das hätte eigentlich seine eigene philosophische Fachtagung (feat. Gadamer, Blumenberg, Odo Marquardt, Julian Nida-Rümelin [warme Begrüßungsworte & Laudatio], Habermas’ türkischen Gemüsehändler und Reinhold Messner) verdient.
In Philosophie II wird diese wohl schon von der LP her bekannte und daher vom Publikum erwartete Sentenz zum nowave-ig gequäkten "Wer seid das!?!", um schließlich in einen evolutionsgeschichtlichen Abriss zu verfallen, dessen Logik sich zur herkömmliche Logik von Geschichtsschreibung als ein die Ursache-mit-der-Wirkung-Ausschütten verhält, und mit der Beschreibung einer prähistorischen Schachtelhalm-Zeit [46] einen erkenntnistheoretischen Problemhorizont eröffnet, der nicht zuletzt auch die Praxis der Geschichtsschreibung selbst betrifft: Erkenntnis kann sich nur von einem ersten Punkt aus vollziehen, der aber dann als Ausgangslage und erster Erkenntnisgrund bereits alles weitere Erkennen affiziert...:
"Es gab Schachtelhalmwiesen, Schachtelhalmbäume, Schachtelhalmtiere, alles war – es gab sogar eine Stadt, die hieß Schachtelhalm: die Stadt Schachtelhalmstadt und Schachtelhalm-Neu-Schachtelheim, Altschachtelheim und die anderen Städte hießen dann, sagen wir mal: Düsseldorf bei Schachtelhalm."
Wohlgemerkt: Es geht nicht darum, ob & inwieweit wir es bei solchen Einlassungen mit Bewusstseins(bzw. Unterbewusstseins-)phänomenen zu tun haben oder mit solchen einer Inspiration, als spräche sich hierin eine in einem dubiosen "Darüber" zu situierende kosmische Instanz aus, die ihr Anliegen in das Gefäß des Dichters pumpt, wie es noch Aristoteles wollte. Das ließe sich freilich durch bloßes Anstaunen erledigen.
Es geht vielmehr darum, eine Methode zu erkennen, deren Arbeitsweise solchen Vexier-Sinn als Abfallprodukt abwirft. Wenn Helge Schneider also in einem Interview darauf besteht, was er mache, sei nicht – wie die Leute glauben – "Unsinn", sondern "Sinn" [47] , so meint er damit nicht jenen festumrissenen, hermeneutisch auslotbaren, immer schon verwalteten und durchherrschten Sinnbegriff der traditionellen Textwissenschaften, sondern einen deterritorialisierten Sinn in Aufruhr, der seinen Totengräber-InterpretInnen permanent von der Schippe tropft, ohne dabei doch vollends aufzuhören, traditioneller Sinn zu sein. Ziel dieser Technik ist aber nicht die Erzeugung von nicht-referentiellem Geräusch (in dem dann Referentialität durch maximale Nicht-Referentialität zur Totalität würde). Seidel sieht hierin vielmehr den Versuch der Bewältigung eines Ausstoßes an Sinn und sprachlichem Sein:
"Nicht nur, daß es eine unvorstellbar große Zahl von mehr oder weniger gewollten Produkten zu bewältigen gilt, erzeugt jedes dieser Produkte eine Reihe ungewollter Sekundärprodukte in Form von Dingen, Konstellationen, Veränderungen, Sorgen, Freuden etc. [...] Um die gerufenen Geister sprachlich bannen zu können, muß der Produktionsmaschine eine Sprachmaschine nachgeschaltet werden, ohne die paradoxe Situation negieren zu wollen, daß die Produktionsmaschine selbst partiell eine Sprachmaschine ist und umgekehrt." [48]
Diese Sprachmaschine besteht bei Schneider – und das macht die Problematik der hier von den Platten abgetippten Belegstellen aus – nicht allein aus der Ebene der Wortbedeutungen. Diese werden ständig von anderen Sinnströmen durchkreuzt: demjenigen der oft freejazzigen Intonation, demjenigen der bei Liveauftritten eminent wichtigen Mimik und Gestik, demjenigen seiner klamaukhaften Accessoires, demjenigen der Pausen, der Lautstärken, der Fehler etc. Die Wort-, Sinn- und Klang(alexander)schlachten, die so ausgetragen werden, implizieren auch immer das Grauen angesichts des Gemetzels eines klaren Gedankens, des Blutbades der Stringenz.
Die Sinn-Unsinns-Verschränkungen bei Helge Schneider funktionieren also völlig anders als die vom Comedy-Bierzelthumor betriebenen Wiederholungen von gesellschaftlichem Sinn als Pseudo-Unsinn. Werden dort traditionelle Denkweisen bis hinab zur dumpfesten Stammtischgesinnung immer nur bestätigt, gelingt es Schneider einem solchen Denken die Kategorien zu entziehen und die Muster zu zerbrechen, ja, sogenanntes abendländisches Denken bisweilen überhaupt zu suspendieren [49] .
Dieser fundamentale Unterschied zwischen Schneider und konformistischen Humorformen zeigt sich gerade da, wo er sich nahe an eines ihrer Medien, die Parodie, heranwagt, die als überzeichnende Darstellung ja der formalen Logik und Ökonomie ihres Gegenstandes verhaftet bleiben muss. Was also nur als maßstabsgetreue Übertreibung existieren kann, wird in der Schneiderschen (Post-)Parodie völlig remodelliert, so dass formal Geronnenes wieder freigesetzt werden kann. Als Beispiel mag hier die Schlager-Kontra-Re-Sub-faktur Ich stand auf der Straße [50] dienen. Die Aneinanderreihung genretypischer Sprachgebilde in leichter Schräglage ("Eine Wolke aus Sehnsucht fliegt über das Tal") und die direkt hintereinander geschaltete Mehrfachverwendung der Endreimpaarungen "sein/allein" und "zurück/Glück" könnten noch verstanden werden als ironisch-parodistischer Hinweis auf die Phrasenhaftigkeit des Genres. Doch schon, dass der durch den Bau des Strophenteils verheißene wuchtige Refrain in einer loopartigen Warteschleife immer wieder aufgeschoben wird, ist ein formaler Eingriff, der abgesehen von seinem komischen Effekt (auf der Sinnebene), das Stück (auf der Klangebene) in eine Form von Psychadelik umbiegt, wie sie z.B. auch Wenzel Storch in seinen Filmen oder der amerikanischen Gruppe WEEN, die wohl bedauerlicherweise in dieser Humor-Testcard nicht behandelt werden wird, vorschwebt. Die Nicht-Parodien und Post-Fakes von WEEN versuchen ja ihre Referenzobjekte ästhetisch (nicht didaktisch!) zu verbessern, was bedeutet, dass sie nicht deshalb ein Marillion-Stück machen, weil sie das eben draufhaben [51] , sondern eines, dass die Vorlage aus ihrer Ekeligkeit, Spätzeitlichkeit und klischeemäßigen Erstarrnis (die z.B. die Parodie ja gerade als Existenzgrundlage braucht) zu erlösen, so dass durch Cheesyness und cooles Referenzwissen hindurch wieder etwas "Quasi-Authentisches" entstehen kann, Phrasen wieder in berührende Tonfolgen und hochkomplexe Erzählungen umgeschmolzen werden.
Dies sieht auch Seidel, wenn er in Ich stand auf der Straße eine "bis in Mikrobereiche vollzogene Annäherung, ja Verschmelzung von Parodie und Original" [52] erkennt. Helge Schneiders Interpretation gibt dem Schlager in der minimalistisch-angedeuteten Instrumentierung wie in den produktiven Eingriffen in dessen typische Gestalt eine längst verlorene Spiritualität und Power zurück.
Eine andere Parodie (zweiter Ordnung) gab Schneider mal in seiner eigenen Off-Show, bei der er ParodistInnen parodierte, wie sie v.a. während der mittleren Kohl-Ära die 3. Programme nach 22 Uhr übervölkerten. Er stellt sich als "Ersatzmann für Thomas Freitag" vor, um sodann das Standardarsenal parodistischer Tristesse miteinander in Dialog zu bringen.
Dieser Dialog kommt jedoch völlig ohne parodiertes PolitikerInnensprech aus, seine Figuren treten sich in einer merkwürdigen, weder zu ihrer Funktion noch zu ihrem öffentlichen Klischee passenden, beinahe barlachartigen Abstraktheit gegenüber (etwa wenn FJS Willy Brandt seinen Strohhut zeigen möchte, was dieser aber – wenn ich mich richtig erinnere – ablehnt). Zusätzlich wird die glatte Präsentationsebene ständig durchlöchert von der Suche nach dem erforderten Tonfall, der typischen Mimik. Schneider bricht mehrmals ab, um sich räuspernd mit "Nee, so, pass auf...!" neu anzusetzen. Die konstitutive Glattheit und Klarsichtfolienhaftigkeit der Parodie wird hierbei soweit aufgerissen, das tatsächlich wieder so etwas wie Kritik hindurchdringen kann, anstelle der bloßen Verdoppelung der Repräsentation.
Und wenn Schneider bei Die Katzenoma DKP-nahes Liedermachertum der 70er in einer irgendwie an Gastr del Sol anklingenden Interpretation aufgreift, wird das in diesem eingeforderte, dann leider an Linientreue eingegangene Prinzip der Solidarität tatsächlich gecovert und nicht verballhornend vorgeführt: "Herr Schlecker, der alte Monopolist, ist schlau" [53] , er hat die Katzenfutter-Billigmarken ganz oben im Regal positioniert, so dass die kleine Oma nicht hinkommt und die teuren nehmen muss. Der Erzähler-Moderator-Schamane des Liedes bündelt nun die spirituellen Energien seines Publikums so, dass die Oma damit zum Schweben gebracht wird. Schleckers Rechnung wird durchkreuzt, emporgetragen von soviel Anteilnahme erwischt sie doch noch das billige Katzenfutter. Dass sie dann schließlich beim Füttern von ihrer monströsen Katze gefressen wird, ist allerdings schon wieder ein ganz andere Geschicht(sphilosophi)e.
Ob Schneider klar ist, was er da tut (und unterlässt) – schwer zu sagen. Äußerungen wie die folgende legen es jedenfalls vehement nahe:
"Zieh dich aus, du alte Hippe hat einen globalen Schwierigkeitsgrad, der niemals unternebelt wird durch etwaige Hilfssprünge. Schneider stellt in seinem Roman ein Bein. Gleichzeitig packt uns eine ungeahnte Angst, die unser Leben bestimmt. Kein Mensch kann sich da heraushalten, es geht uns alle an. Mit dem Kauf dieses Buches wird man auf eine Fährte gesetzt." [54] .
Inwieweit diese "Fährte" tatsächlich der Derridaschen "Ur-Spur" entspricht, sei für weitere Forschungsaktivität einfach mal in handlicher Form so dahingestellt.
Noch gibt es die ja in einer derart eklatanten Weise nicht, dass Schneider sich selbst per Klappentext nachrufen kann "Helge Schneider, geboren 1903, ist in der Literatur ein Außenseiter geblieben." [55]
[1] Diesen Hinweis verdanke ich einer erbosten Leserinnenzuschrift an den Gong.
[2] Zitiert nach Jörg Seidel: Ondologie Fanomenologie Kynethik. Philosophieren nach Helge Schneider. Essen 1999. S. 7.
[3] Jens Hagestedt: Mühlheim an der Ruhr. Versuch über Helge Schneider. Ein Essay. Deutschlandfunk 1996.
[4] Eckhard Schuhmacher: Das Stolpern der Banalität. Über Helge Schneider. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. H. 9/10. Okt. 1998. 52. Jg. S. 995-998.
[5] Vgl. Helge Schneider: Guten Tach. Auf Wiedersehen. Autobiographie, Teil I. Köln 1992. S. 9.
[6] Vgl. Frank Apunkt Schneider: The Jazz of Consciousness. Prolegomena zu einer jeden Helge Schneider-Betrachtung, die als nicht-feuilletonistisch wird auftreten können. In: Bad Alchemy 33. S. 3-11. In überarbeiteter Fassung nachgedruckt in monochrom 11-14einhalb.
[7] Jörg Seidel: Ondologie Fanomenologie Kynethik. Philosophieren nach Helge Schneider. Essen 1999.
[8] Ebd. S. 95.
[9] Ebd. S. 103.
[10] Hierauf hat unlängst Georg P. Thomann in einem Interview hingewiesen. (Vgl. Die Presse. 19/20.01.2002. S. 16.)
[11] Diedrich Diederichsen: Die Simpsons der Gesellschaft. In: Spex 1/99. S. 40-42. S. 41.
[12] Hiervon auszunehmen wären z.B. die wesentlich komplexeren Erzählungen Marc Twains, der allerdings häufig als Satiriker geführt wird.
[13] Kann in diesem Rahmen leider nicht ausführlich behandelt und mit entsprechendem Material angereichert werden. Hier muss der Hinweis auf den Zusammenhang genügen.
[14] Diesbezügliches Interpretationsportal: Anders als alle anderen Figuren der Filme oder Sketche der Gruppe ist der Protagonist ja nicht in irgendwie lustiger Weise deformiert oder neben der Spur, sondern beharrt im Zentrum des montypythonesken "Blödsinns" auf einen bestimmten Typus einer politisch tätigen Vernunft, wie sie direkt anarchistischer Theoriebildung entnommen zu sein scheint.
[15] Max Goldt: >Mindboggling< - Evening Post. Zürich 2001. S. 186f.
[16] Der Philosoph Stephan Günzel im persönlichen Gespräch (in Anlehnung an Adornos Diktum "Fun ist ein Stahlbad").
[17] In Swinger-Clubs wird das angepeilte Prinzip der Entgrenzung ja mit zahlreichen Grenzziehungen, in denen sich die realen Machtverhältnisse abkonterfeien, abgesichert gegen etwaige Einbrüche des Anderen: Zärtlichkeiten sind zwischen Frauen zwar toleriert, ja erwünscht, zwischen Männern aber verboten und neulich sagte mal ein Typ in einer Fernsehdoku, was er an seinem Club so schätze, sei, dass da keine Ausländer reindürfen.
[18] Z.B. durch Konzertabbruch bei bestimmten, ihm gegen den Strich gehenden Aggregatzuständen von "Publikum".
[19] Vgl. Marcel Malchowski: Den ich Ruf rief, den Geist. In: TAZ. 7./8..Juli. 2001. S. 22.
[20] Hape Kerkeling hat in einem seiner Filme gezeigt, dass man/frau/sonstige auch deutsche TV-Komödien abliefern kann, die sich soviel Restwachheit und Humor bewahrt haben, derlei Stereotypisierung nicht bloß satirisch zu zitieren, sondern überhaupt mal zu durchbrechen: Als die deutsche Familie aus der polnischen Raststätte kommt, ist selbstredend das Auto plötzlich nicht mehr da; Schnitt: wir sehen zwei nach dem Thelma&Louise-Prinzip gemodelte deutsche Frauen, die im gestohlenen Wagen vor irgendeiner Road Movie-Handlung fliehen.
[21] Titel einer von monochrom am 9.12.99 im Wiener Depot veranstalteten Podiumsdiskussion zum Werke Schneiders.
[22] Z.B. wenn Ben Becker bei Biolek dem uncool konnotierten Guido Westerwelle öffentlich ein Rauchpiece anbietet, um sozusagen das Prinzip FDP auf dem Feld des symbolischen Kapitals zu wiederholen.
[23] Vgl. Schneider: The Jazz of Consciousness.
[24] Vgl. hierzu Seidel: Ondologie. S. 308f.
[25] Ebd. S. 173.
[26] Ebd. S. 175.
[27] Max Goldt: Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau. Zürich 1993. S. 116.
[28] Aus: Pubertät. Auf: Helge Schneider: Guten Tach. LP. Roof Music 1992.
[29] Vgl. Seidel: Ondologie. S. 72.
[30] Bei einem Liveauftritt. Zitiert aus meiner Erinnerung.
[31] Vgl. hierzu Gilles Deleuze/Félix Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur. Ffm 1976. Zum sich aufdrängenden Kafka-Vergleich meint Seidel: "Sicher, auf den ersten Blick wird die Konstruktion eines Bezuges zwischen Kafka und Schneider befremdlich, wenn nicht blasphemisch wirken, doch sind bei genauer Hinsicht die kafkaesken Momente im Schaffen des Humoristen durchaus wahrnehmbar." (Seidel: Ondologie. S. 134.)
[32] Vgl. die kaleidoskopische Abfolge jahreszeitlich bedingter Stimmungsbilder und klimatischer Effekte in Pariserzählung (Auf: Helge Schneider: New York I’m coming. LP. Roof Music 1990.); das Stück kann lange gar nicht als Bericht von Ereignissen einsetzen, weil ständig neue Zeitangaben ständig neue Welten generieren, die beschrieben werden wollen.
[33] Über eine Autofahrt berichtet Schneider: "Die Geschwindigkeit war so hoch, dass der Raum dreidimensional war." (Flora und Fauna. Auf: Helge Schneider: Katzeklo. MCD. Roof Music 1993.)
[34] Vgl. Langeweile. Auf: Helge Schneider: Hörspiele Vol. 2. 1985-1987. CD. Roof Music 1992.
[35] Etwa die endlose, aber halsbrecherisch choreographierte Aufzählung der drei Benelux-Länder in Ansprache (Auf: New York I’m coming).
[36] In der Pariserzählung bekommt der Protagonist nach einem Zusammenbruch infolge des Verzehrs von ca. 190-220 Capuccinos in einer 900stündigen Operation einen Herzschrittmacher eingepflanzt.
[37] Vgl. hierzu Christina Rauch: Pflaumen vom Mars – Bekanntes im Fremden der Science Fiction. In: Testcard 10. S. 170-173.
[38] Zur Metapher des Knäuels, das durch sich selbst ausgesagt wird, vgl. Operette für eine Katze (Orang Utan Klaus). Auf: Helge Schneider: Es gibt Reis, Baby! Do-CD. Roof Music 1993.
[39] Seidel: Ondologie. S. 54.
[40] Völlig auseinanderdriftende Versionen sind mir bekannt von der Maxi-CD Katzeklo Spectaculaire! (MCD. Roof Music 1994), einem Livekonzert sowie unter dem Titel Videoprodukt auf Da Humm (Do-CD. Roof Music 1997).
[41] Zitiert aus der Erinnerung. S. 15764735802 f.
[42] Helge Schneider: Videoklip. Auf: Katzeklo Spectaculaire! MCD. Roof Music 1994.
[43] Wenn Schneider hingegen tatsächlich mal ein Video vorlegt (wie zu Es gibt Reis, Baby!), sind das eher zwischen Tür und Angel runtergerotzte LoFi-Super-8-Formate.
[44] Helge Schneider: Videoprodukt.
[45] Alle Textbeispiele aus Philosophie (Auf: Helge Schneider: Guten Tach.) und Philosophie II (Auf: Helge Schneider: Telefonmann. MCD. Roof Music 1994).
[46] Eine Pflanze(nart), die übrigens auch dem- und derjenigen begegnet, der/die es schafft, den auf der Umschlagsinnenseite der Merve-Ausgabe des Rhizoms in bewußt miserabler Qualität abgedruckten Eintrag aus einem botanischen Nachschlagewerk zu entziffern[!].
[47] Zitiert nach Seidel: Ondologie. S. 30.
[48] Ebd. S. 23f.
[49] vgl. dazu auch Ebd. S. 16.
[50] Auf: Helge Schneider: New York I’m coming.
[51] Vgl. She wanted to leave. Auf: Ween: The Mollusk. CD. Warner 1997.
[52] Seidel: Ondologie. S. 287.
[53] Helge Schneider: Die Katzenoma. Auf: Ders.: Hefte raus – Klassenarbeit! DoCD Roof Music 2000.
[54] Klappentext zu Helge Schneider: Zieh Dich aus, du alte Hippe. Kriminalroman. Köln 1994. S. 3.
[55] Helge Schneider: Der Scheich mit der Hundehaarallergie. Kommissar Schneider flippt extrem aus. Köln 2001. S. 3
Dieser
Text erschien erstmals in Testcard
#11. Frank
Apunkt Schneiders Text "The Jazz of Consciousness. Prologomena
zu einer jeden Helge-Schneider-Betrachtung, die als nicht-feuilletonistisch
wird auftreten können", der sich auch mit dem Phänomen
Helge Schneider beschäftigt, findet sich in monochrom
#11-14 1/2.